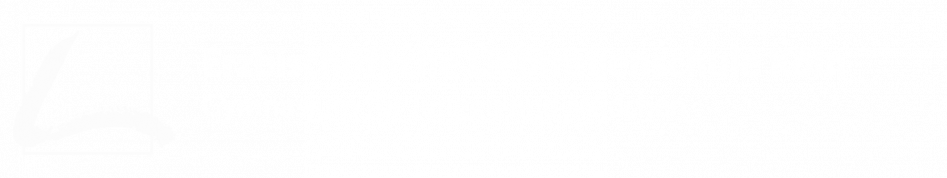Mitte März unternahmen wir eine Exkursion in Köln, um den RheinEnergie-Fernwärmetunnel zu besichtigen. Ziel dieser Exkursion war es, mehr über die Infrastruktur und das System der Fernwärmeversorgung und den Einsatz erneuerbarer Energien in unserer Stadt Köln zu erfahren. Da der Tunnel unterhalb des Rheins verläuft und eine bedeutende Verbindung für die Kölner Energieversorgung zwischen der Altstadt und Deutz darstellt, war es besonders spannend, einmal selbst in diese unterirdische Welt einzutauchen. Durch die vorherigen Unterrichtskenntnisse hatte ich eine grobe Vorstellung des Systems und der Funktionsweise der Fernwärme, aber mir war noch nicht ganz bewusst, welche Rolle solch ein Tunnel wie der Fernwärmetunnel der RheinEnergie für eine nachhaltige Energieversorgung spielt und wie dieser errichtet wurde. Daher war ich gespannt darauf, neue Erkenntnisse zu gewinnen und den Tunnel selber zu durchlaufen. Wir trafen uns um 11:50 vor dem Schultor und machten uns auf den Weg zur Deutzer Seite der Hohenzollernbrücke, wo sich der Einstieg zum Tunnel befindet..
Wir wurden dort von einem RheinEnergie-Mitarbeiter empfangen und so begannen wir unseren geführten Abstieg in die Tiefe durch ein von außen eher unscheinbar wirkendes kleines Gebäude, welches nicht so erschien, als wäre dies der Eingang zu einem fast 500m langem Tunnel. Über ein Gitterrost mit etwa 100 Stufen ging es rund 25 Meter runter. Unten im Tunnel angelangt bekamen wir eine Einführung in die Geschichte und Funktion des Tunnels. Unser Guide erklärte, dass der Fernwärmetunnel eine wichtige Verbindung für die Wärmenetze in Köln darstellt und bereits seit den frühen 1980er Jahren in Betrieb ist. Zudem erklärte er, dass der Tunnel mit dem Rohrvortriebsverfahren gebaut wurde, was bedeutet, dass er Stück für Stück unter dem Rhein hindurchgeschoben wurde, ohne dass eine offene Bauweise nötig war. Davor wurde jedoch erst einmal ein kleiner ovaler Graben mit einer Tiefe von 3m gegraben und das erste Betonstück wurde eingelassen. Dieser Vorgang wurde solange wiederholt bis die aufeinander folgenden Betonrohre die gewünschte Tiefe erreichten. Der Boden musste aufgrund des noch hohen Wasserbestandes in diesem Graben von Tauchern mithilfe von Wasserbeton zum Schluss hinzugefügt werden. Sobald diese Grundlage geschaffen war, wurde auf dem Boden eine hydraulische Presse aufgestellt, welche dabei half das Rohrvortriebsverfahren umzusetzen.
Sobald das erste Rohrstück vorangetrieben wurde, wurde das nächste Rohrstück dahinter eingesetzt und mit hoher Presskraft weitergeschoben. Beim Einsetzen des letzten Rohrstückes kam das erste Rohrstück also im Zielschacht an. Dabei spielte eine genau Arbeit eine große Rolle. Der Baukopf, welcher als erstes Bestandteil durch den Tunnel geschoben wurde, verfügte über Lasersensoren, welche den genauen Tunnelbau ermöglichten. Die letztendliche Abweichungen von dem geplanten Tunnelbau betrugen am Ende der Bauphase nur rund 1,6 cm. Zudem erklärte uns unser Führer die Funktionsweise der Fernwärme. Die großen Rohrleitungen, die wir sehen konnten und auch anfassen durften, transportieren heißes Wasser mit Temperaturen von bis zu 130 Grad Celsius, die in verschiedenen Kraftwerken der Stadt erhitzt werden und anschließend als Heizenergie in Haushalte und Gebäude geleitet wird. Dabei fand ich es besonders interessant, dass das Wasser mit 12 bar Druck durch die Rohre fließt, sodass der Verdampfungsprozess nicht stattfinden kann, sondern dass das Wasser trotz der hohen Temperaturen weiterhin im flüssigen Zustand durch die Rohre fließt. In den Haushalten fließt das kalte Wasser dann wieder zurück und dies wird wiederverwendet und danach wieder in den Kraftwerken erhitz . Noch bevor wir den Tunnel betraten, zeigte uns unser Führer ehemalige Überbleibsel des 2. Weltkrieges, nämlich Bauteile der alten Hohenzollernbrücke und Steine, welche die Bauarbeiten für ein paar Stunden aufhielten. Glücklicherweise hat sich bei der Errichtung des Fernwärmetunnels kein Arbeiter verletzt. Als wir nun endlich den Tunnel betraten, gingen wir alle nach einander hindurch. In der Mitte des Tunnels machten wir beim blauen Licht halt, welches dazu dient eine Unterwasser Atmosphäre zu erzeugen (siehe Foto). Wir durften uns auf die Rohre setzen, durch welche das Wasser zu den Haushalten und von den Haushalten wieder zurück fießt. Dabei konnte man allerdings nur einen kleinen Temperaturunterschied wahrnehmen obwohl dieser um die 100 Grad Celsius beträgt. Wir konnten ebenfalls ein Knattern hören, welches sich den hinüberfahrenden Schiffen und dessen Schiffsschrauben zuordnen ließ. Als wir nach einer kurzen Pause den Tunnel wieder bis zum Ende durchquerten und im Zielschacht die Treppe wieder hoch stiegen, wurde es plötzlich wärmer durch die Stauung der Wärme in den knapp 500 Meter langem Tunnel. Auf der anderen Rheinseite angekommen, endete unsere Exkursion und wir machten uns alle auf den Rückweg.
Insgesamt war die Exkursion sehr spannend, da ich viele Informationen über die Bauart des Tunnels gelernt habe, unter anderem auch das Rohrvortriebsverfahren. Besonders gut hat mir das Gefühl, zu wissen, das man unter dem Rhein steht, und allgemein dieses einzigartige Erfahrung an sich gefallen und auch das mein Wissen zu der Fernwärmeenergie durch das eigene Durchlaufen des Tunnels und durch die aufgestellten Infokarten gefestigt und untermauert wurde. Abschließend kann ich also festhalten, dass ich jedem diese Exkursion empfehlen kann!